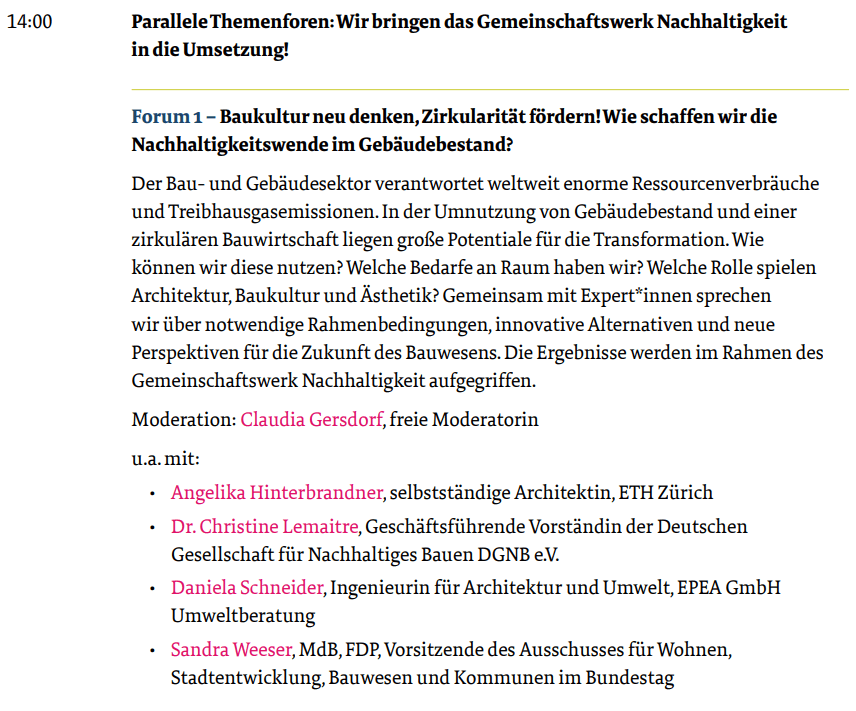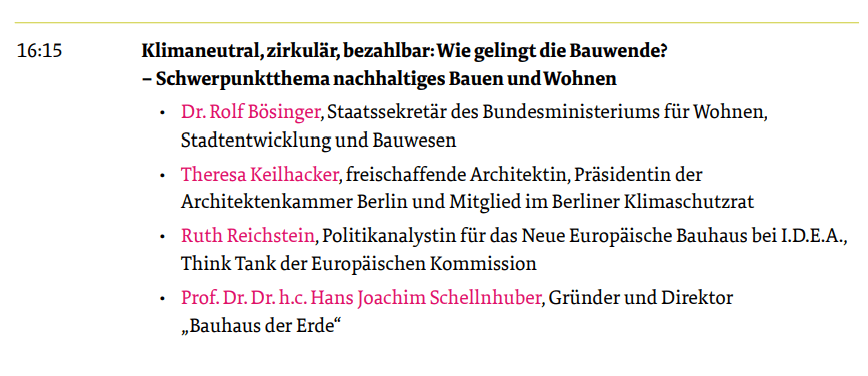Ohne eine echte Bauwende sind die Klimaziele nicht zu erreichen. Es geht dabei um weit mehr als nur um technische Lösungen für energieeffizientere Gebäude: Es geht um eine neue Ästhetik und eine neue Baukultur.

Das Projekt San Gimignano Lichtenberg in Berlin von b+ Architekten setzt auf Umnutzung statt Ab- oder Umbau im Gebäudebestand. Foto: bplus © Erica Overmeer
Im März 2020 veröffentlichte der französische Philosoph Bruno Latour einen Aufsatz mit einem bestechend simplen Gedanken: Wäre es nicht schade, nach der Corona-Krise einfach weiterzumachen wie bisher, statt daraus Lehren für eine noch größere Bedrohung zu ziehen: die ökologische Zerstörung unserer Lebensgrundlagen? Die weltweite Industrieproduktion also einfach wieder auf Prä-Corona-Zeiten hochfahren? „Auf keinen Fall“, schrieb Latour.
Diesen Gedanken inspirierte die schweizerische Architektin und Stadtplanerin Charlotte Malterre-Barthes, die an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne und der Harvard Graduate School of Design lehrt. Sie rief dazu auf, weltweit nichts Neues mehr zu bauen – a Global Moratorium on New Construction hieß ihre Schrift. Bauen, argumentierte Malterre-Barthes, braucht enorme Mengen an Rohstoffen, deren Gewinnung Unmengen an Energie verschlingt und die Natur zerstört. Nichts mehr zu bauen, auch nur zeitweise, könne das Narrativ des Fortschritts, des Techno-Positivismus und des ewigen Wachstums in Frage stellen, das in kapitalistischen Gesellschaften herrscht, schrieb die Architektin. Das könne eine Verschiebung ihres Wertekanons bewirken und Ökologie wichtiger machen als das Mantra, immer mehr zu bauen, schrieb sie.
Malterre-Barthes utopischer Einwurf befeuert seitdem Debatten um mehr Nachhaltigkeit im Bausektor. Der Rat für Nachhaltige Entwicklung erklärt das Thema „Nachhaltiges Bauen und Wohnen“ zum ersten Schwerpunktthema des Gemeinschaftswerk Nachhaltigkeit, ein gemeinsames Vorhaben von Bund und Ländern, welches auf der diesjährigen Jahreskonferenz am 26. September gestartet wird. Auf der RNE-Jahreskonferenz widmet sich deshalb ein eigenes Themenforum der Frage „Baukultur neu denken, Zirkularität fördern! Wie schaffen wir die Nachhaltigkeitswende im Gebäudebestand?“ Es geht dabei auch darum, wie der Gebäudebestand umgenutzt werden kann, statt ständig neu zu bauen. Kann es eine wirklich zirkuläre Bauwirtschaft geben, weg vom ewigen Extraktivismus? Wie viel Raum braucht es überhaupt – und welche Rolle spielen Architektur, Baukultur und Ästhetik?
Frauen machen die Bauwende konkret: das Forum auf der RNE-Jahreskonferenz
Diskutieren werden das Thema fünf Frauen, die eine Menge praktische Erfahrung mitbringen und konkret an einem Wandel in der Bauindustrie arbeiten: Angelika Hinterbrandner ist selbstständige Architektin und lehrt an der ETH Zürich, Christine Lemaitre, ist Geschäftsführende Vorständin der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen. Dazu kommen Daniela Schneider, die als Ingenieurin für Architektur und Umwelt bei der EPEA GmbH Umweltberatung Projekte leitet, sowie Sandra Weeser. Die FDP-Politikerin ist Vorsitzende des Ausschusses für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen im Bundestag. Moderiert wird das Panel von Claudia Gersdorf, einer erfahrenen Nachhaltigkeitskommunikatorin.
Wie dringlich eine Nachhaltigkeitswende im Gebäudebestand ist, steht im jährlich erscheinenden Statusbericht über den globalen Gebäude- und Bausektor des UN Umweltprogramms UNEP: „Um die Pariser Klimaziele einzuhalten muss der weltweite Bau- und Gebäudesektor bis 2050 fast komplett dekarbonisiert werden“, heißt es darin. Derzeit entfallen 36 Prozent des weltweiten Endenergieverbrauchs und 37 Prozent der energiebezogenen CO2-Emissionen auf den Sektor, darin enthalten sind zehn Prozent der globalen, energiebezogenen CO2-Emissionen, die durch den Bau neuer Gebäude entstehen. Die Wende in dem Sektor braucht dabei offenbar weit mehr als nur technische Lösungen Gerade erst hat der Expertenrat für Klimafragen das Klimaschutz-Sofortprogramm der Bundesregierung für den Gebäudesektor als mangelhaft beurteilt. Die EU verspricht indes eine Renovierungswelle und eine Kreislaufwirtschaft auch im Bausektor, doch das sei nicht nur ein Wirtschafts- und Umweltprojekt, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union 2020. „Jede Bewegung hat ihr eigenes Gefühl. Wir müssen dieser Transformation ein Gesicht verleihen – um Nachhaltigkeit mit einer eigenen Ästhetik zu verbinden“, sagte von der Leyen.
Das sieht auch Angelika Hinterbrandner so. „Wir müssen Nachhaltigkeit, Kultur und Sichtbarmachung verschränken, um dem elementaren Wandel, der uns bevorsteht, einen Ausdruck zu verleihen und die Gesamtgesellschaft miteinzubeziehen“, sagt sie. Für Hinterbrandner ist Zirkularität dabei nur eine Option. Alles nur darauf zu optimieren, könne dazu führen, dass mehr abgerissen wird. „Primär müssen wir uns aber um das kümmern, was bereits besteht und bereits Gebautes weiterverwenden, neu denken und weiternutzen“, sagt sie. „Zirkularität, Umnutzung und alternative, nicht erdölbasierte Materialien wie Lehm, Stroh und andere könnten eine neue Ästhetik hervorbringen, die Menschen begeistert“, ergänzt Hinterbrandner.
400.000 neue Wohnungen pro Jahr, muss das sein?
Die Idee einer neuen Baukultur ist eigentlich längst auf höchster Ebene angekommen. Hinterbrandner verweist auf die Kulturministerinnen und Kulturminister Europas, die sich 2018 auf eine Charta für eine hohe Baukultur in Europa einigten. Hohe Baukultur entspreche nicht nur funktionalen, technischen und ökonomischen Anforderungen, sondern auch sozialen und psychologischen Bedürfnissen der Bevölkerung, heißt es darin.
Um das praktisch umzusetzen, bedarf es eines Wandels auf allen Ebenen. Charlotte Malterre-Barthes etwa schreibt von einem neuen Selbstverständnis von Architekt*innen. Sie seien von hoher Wichtigkeit, um unsere Welt zu erhalten, fortzuführen und zu reparieren, damit alle gut darin leben können, heißt es in ihrem Aufruf zum Moratorium. Für Hinterbrandner geht es auch darum, der Politik zu zeigen, dass es Alternativen zu energieeffizienten Neubauten gibt. Oder der üblichen Praxis, Altbauten einfach mit auf Erdöl basierenden Verbundsystemen energetisch zu sanieren.
„Man muss grundsätzlich verstehen, dass der politische Diskurs stark von einer Bau- und Materiallobby beeinflusst ist und die will vor allem Neubauten. Nutzen, was schon da ist, das heißt einerseits komplexere Prozesse und oft auch weniger Profit“, sagt Hinterbrandner. Die Zivilgesellschaft versucht längst, dagegenzuhalten. So hat im Januar ein breites Bündnis von Organisationen um ‘Architects 4 Future’ die Bundesregierung aufgerufen, beim Wohnungsbau grundsätzlich umzudenken – Basis war eine erfolgreiche Petition zu dem Thema mit anschließender Anhörung im Bundestag: Statt, wie angekündigt, 400.000 Wohnungen pro Jahr neu zu bauen, sollen primär Bestandsgebäude umgenutzt werden.
Ein erster Schritt hierzu wäre, so Hinterbrandner, überhaupt einmal systematisch zu erfassen, wie hoch das Potential hierzu bundesweit wäre. Noch fehlten Daten dazu, sagt sie. Auch die Bundesstiftung Baukultur empfiehlt, vorhandene Potentiale zu nutzen: „Die Möglichkeiten erstrecken sich von Leerstands-, Frei- oder Brachflächenaktivierungen bis hin zu baulichen Maßnahmen wie Baulückenschlüssen, Aufstockungen und Ergänzungsbauten“, schreibt die Stiftung. Hinzu kommt, dass nach der Pandemie in Innenstädten einiges an Bürofläche leer bleiben dürfte, ergänzt Hinterbrandner.
Heidelberg als Rohstoffquelle
Die Bauwende hat tatsächlich bereits Vorreiter. Die Stadt Heidelberg etwa will Europas erste kreislauffähige Kommune werden – und die Stadt selbst als Rohstoffquelle nutzen, Stichwort urban mining. Dazu erfasst die Stadt systematisch den Gebäudebestand und die darin verbauten Materialien. „Circular City – Gebäude-Materialkataster für die Stadt Heidelberg“, heißt das Vorhaben, das von HeidelbergCement AG unterstützt wird. Das Unternehmen will mit dem Pilotprojekt „ReConcrete-360°“ Abrissbeton sortenrein trennen, damit es für neue Baustoffe genutzt werden kann.
Allerdings, gibt Hinterbrandner zu bedenken, verursacht die Herstellung von Beton bis zu acht Prozent der globalen CO2-Emissionen. Sie verweist auf Leuchtturmprojekte, die zeigen, wie sich Bestandsgebäude anders nutzen oder erweitern lassen können. Als Beispiel nennt sie den Erweiterungsbau des Landratsamts Starnberg. Das ursprünglich 1987 fertig gestellte zweigeschossige Gebäude ist ein Hybrid aus Holz, Stahl und Beton in modularer Bauweise und wurde 2021 erweitert. Ein weiteres von vielen Beispielen sei die Integrierte Gesamtschule im niedersächsischen Rinteln. Dort ergänzt ein Neubau den Bestand, die Fassade besteht aus Lärchenholz aus dem eigenen Forstbetrieb des Bauherrn.
Solche Beispiele müssten Schule machen, sagt Hinterbrandner. Denn der Weg zur Bauwende ist weit und muss bis 2050 geschafft sein, sonst ist Klimaneutralität nicht zu erreichen. „Es entsteht ein komplett neuer Weg, wie wir die Welt designen und wahrnehmen“, schreibt Malterre-Barthes hoffnungsvoll. Es gelte, ihn sich vorzustellen, zu formulieren, zu planen – und umzusetzen.
Das Thema Bauwende auf der 21. Jahreskonferenz des RNE am 26. September 2022: